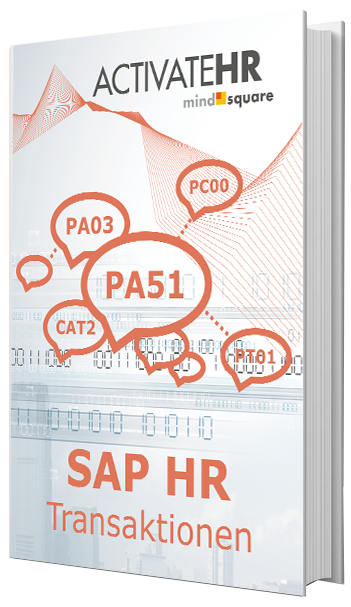Kinder sind was Wunderbares! So unschuldig. So spontan. Sie leben im Hier und Jetzt. „Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun“, sang Herbert Grönemeyer 1986 in dem Song „Kinder an die Macht“. Ach wie schön wäre das Leben, wenn wir alle wären wie die Kinder!
Kinder sind Egoisten. Sie wollen alles haben. Für sich. Nur für sich. Und zwar sofort. Vertrauen sollte man ihnen besser nicht. Sie missbrauchen es in aller Regel.
Es spricht manches dafür, dass diese zweite Sichtweise der Realität näher ist. Dass das Kind der bessere Homo Oeconomicus ist, in dem Sinne, dass es seinen Nutzen ohne Rücksicht auf Verluste maximiert. Nicht weil Kinder böse wären, sondern weil es ihrer Natur entspricht. Weil sie noch nicht anders können.
Matthias Sutter und Martin Kocher, zwei Ökonomen, die sich der experimentellen Wissenschaft verschrieben haben, lieferten bereits 2006 für letztere Sichtweise einen eindrücklichen Beleg. Und zwar mit dem so genannten Vertrauensspiel, einem Experiment, das folgendermaßen aufgebaut ist: Eine Versuchsperson erhält 10 Euro und kann entscheiden, wie viel sie davon behält und wie viel sie einer zweiten Versuchsperson abgibt. Der abgegebene Betrag wird bei der Übergabe vom Versuchsleiter verdreifacht. Die zweite Versuchsperson kann nun ihrerseits entscheiden, wie viel sie von diesem verdreifachten Betrag der ersten Person zurückgibt. Reicht die erste Versuchsperson beispielsweise das ganze Geld an die zweite Person weiter und teilt diese hälftig, haben beide Teilnehmer am Ende 15 Euro.
Das Experiment ist also derart konstruiert, dass sich beide Versuchspersonen dann besser stellen, wenn sie kooperieren. Allerdings muss die erste Person darauf vertrauen, dass die zweite Person fair handelt.
Sutter und Kocher haben das Experiment mit 662 Versuchspersonen aller Altersgruppen durchgeführt, von 8-jährigen Grundschülern bis zu Rentnern. Ihr Fazit: Das Vertrauen nimmt linear mit dem Lebensalter zu. Die Grundschüler gaben im Schnitt nur 2 Euro ab und bekamen lediglich 66 Cent zurück. Sie machten also einen Verlust von 1,34 Euro. 16-Jährige gaben durchschnittlich 5,46 Euro und bekamen 5,15 Euro zurück. Bei den Erwachsenen drehte sich das Bild. Ob Studenten, Berufstätige oder Rentner: Sie alle erhielten mehr zurück als sie gegeben hatten. (Am meisten gaben übrigens die Berufstätigen mit 6,58 Euro; sie erhielten im Schnitt 9,03 Euro zurück.)
Das Experiment zeigt: Die Fähigkeit zu vertrauen mag in uns angelegt sein, wir müssen sie dennoch erst lernen. Machen viele diese Erfahrung, lebt es sich in einer Gesellschaft besser. Zum Beispiel im Arbeitsleben: Wer vertraut, braucht keine detaillierten Verträge oder ein ausgeklügeltes Überwachungssystem. Vertrauen spart Aufwand, Zeit und Geld.
Allerdings: Wer vertraut und kooperiert, handelt nicht selbstlos. Seine Motive sind letztlich egoistischer Natur. Denn wird sein Vertrauen nicht missbraucht, erhält er am Ende mehr zurück als er gegeben hat. Woher aber kommt der Altruismus? Warum hat die Evolution einen Charakterzug hervorgebracht, bei dem sich einer zurücknimmt, damit es anderen besser geht? Wo doch, wer sich zurücknimmt und im Extremfall sogar sein Leben opfert, schlechtere Chancen hat, seine Gene weiterzugeben, weshalb es genetisch bedingten Altruismus eigentlich gar nicht geben dürfte.
Gibt es aber. Etwa innerhalb von Familien. Dort ist der Charakterzug offensichtlich vorteilhaft. Eltern verzichten auf ihr eigenes Wohlergehen (kein Urlaub, kein neues Auto, kein entspanntes Leben) und investieren dafür in ihre Kinder (gute Erziehung, teure Ausbildung). Der Altruismus der Eltern sorgt dafür, dass letztlich ihre eigenen Gene weiter bestehen.
Doch altruistisches Verhalten ist nicht alleine auf die Familie beschränkt. Es kommt auch in Gruppen, in der Gesellschaft vor. Warum? Eine mögliche Erklärung: Altruistisches Verhalten bringt eine besonders stabile Form der Kooperation hervor, wodurch die eine Gruppe erfolgreicher wird als die andere. Diese stabile Kooperationsform lässt sich beispielhaft an einer „Zwei-Personen-Gesellschaft“ beschreiben, in der ein Altruist und ein Begünstigter lebt. Der Altruist steigert (quasi per Definition) seinen Nutzen dadurch, dass es dem Begünstigten besser geht. Gibt er also von seinem Vermögen ab, erhöht dies auch seinen eigenen Nutzen. Dem Begünstigten geht es dagegen dann besser, wenn der Altruist mehr hat, denn dann erhält auch er einen größeren Anteil. Beide verfolgen also das gleiche Ziel, nämlich dass es dem Altruisten besser geht. Es gibt folglich keine Konkurrenz innerhalb dieser Gruppe, das Zusammenleben funktioniert reibungslos.
Die stabile Beziehung von Altruisten und Begünstigten kann erklären, warum der Altruismus eine erfolgreiche Lebensform ist und warum Gruppen, in denen Altruisten leben, erfolgreicher sind (schneller wachsen) als andere. Allerdings: Auch das altruistische Gen muss, will es überleben, weitergegeben werden. Der Altruist aber opfert ja gerade seinen eigenen Reproduktionserfolg dem Erfolg der Gruppe.
Sterben also die Altruisten aus? Nicht zwingend: Denn es konkurrieren zwei Entwicklungen miteinander. Auf der einen Seite werden Altruisten innerhalb einer Gruppe weniger, auf der anderen Seite verdrängen diese schnell wachsenden „Altruisten“-Gruppen, jene Gesellschaften, in denen es wenige oder keine Altruisten gibt. Überwiegt die erste die zweite Entwicklung, überlebt der Altruismus.
Einsortiert unter:Gesellschaft Tagged: Altruismus, Evolution, Kooperation, Martin Kocher, Martin Sutter, Trust Game, Vertrauen